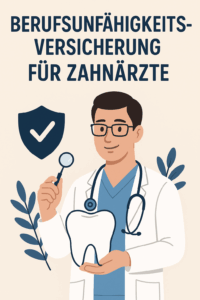

Berufsunfähigkeitsversicherung für Zahnärzte
Für Zahnärztinnen und Zahnärzte ist die eigene Arbeitskraft meist der größte wirtschaftliche Wert – und gleichzeitig der verletzlichste. Jahre der Ausbildung, ein hochspezialisierter Berufsalltag und häufig hohe finanzielle Verpflichtungen (Praxis, Familie, Immobilien) treffen auf ein Versorgungswerk, das nur in Extremfällen eine Invaliditätsrente zahlt. Dieser Leitfaden zeigt, warum eine private Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) für Zahnärzte praktisch unverzichtbar ist und wie eine sinnvolle Absicherung konkret aussehen sollte.
Der Text richtet sich an Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland – von der Assistenzzeit über angestellte Tätigkeiten bis hin zu (geplanten) Praxisinhabern.
Individuelle Einschätzung Ihrer BU-Situation als Zahnarzt/Zahnärztin
Sie möchten wissen, ob Ihre aktuelle Absicherung zu Einkommen, Versorgungswerk und Praxisplänen passt?
Beratung zur BU für Zahnärzte anfragen1. Einleitung: Warum BU für Zahnärzte kein „Luxus-Thema“ ist
1.1 Was steht auf dem Spiel?
Der Weg in die Zahnmedizin ist lang und teuer: Studium, Assistenzzeit, häufig Fortbildungen und Spezialisierungen, später ggf. Praxisgründung mit sechsstelligen Investitionen. Die laufenden Kosten sind hoch – privat wie beruflich:
- Miete oder Finanzierung von Wohnung oder Haus
- Unterhalt der Familie
- Tilgung von Studien- oder Praxisdarlehen
- Praxisfixkosten (Miete, Personal, Leasingverträge)
- Beiträge zum Versorgungswerk und zu Versicherungen
Fällt die zahnärztliche Tätigkeit weg – sei es durch einen Unfall, Erkrankungen des Bewegungsapparats, Probleme mit den Augen oder psychische Belastungen – bricht dieses Einkommen oftmals von einem Tag auf den anderen weg. Genau hier greift eine private Berufsunfähigkeitsversicherung, indem sie eine monatliche Rente zahlt, wenn die bisherige Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden kann.
1.2 Typische Fehlannahmen von Zahnärzten
In Gesprächen mit Zahnärztinnen und Zahnärzten tauchen immer wieder ähnliche Aussagen auf:
- „Ich habe doch das Versorgungswerk, das reicht.“
- „Ich kümmere mich um BU, wenn ich mich niederlasse.“
- „Ich verdiene in der Assistenzzeit noch nicht genug, das lohnt noch nicht.“
Alle drei Annahmen sind riskant. Das Versorgungswerk zahlt nur bei sehr strenger Definition von Berufsunfähigkeit, die Niederlassung kommt oft später als geplant – und mit jedem weiteren Jahr steigt das Risiko, dass Vorerkrankungen zu Zuschlägen oder Ausschlüssen führen. Ein strategischer BU-Schutz setzt deshalb früh an.
Wann ist der beste Zeitpunkt für eine BU als Zahnarzt?
Viele angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte verschieben das Thema „private BU“ auf den Zeitpunkt der Praxisgründung – in der Annahme, dann mehr zu verdienen und „es richtig zu machen“. Aus Sicht der Versicherer ist das jedoch oft zu spät:
- Gesundheit: Mit Anfang/Mitte 30 ist die Gesundheitsakte meist noch überschaubar. Erste Rückenprobleme, orthopädische Befunde oder psychische Belastungen sind später häufige Gründe für Risikozuschläge oder Ausschlüsse.
- Beiträge: Je jünger beim Abschluss, desto niedriger der Beitrag für die gesamte Laufzeit.
- Nachversicherung: Gute Tarife bieten bei Praxisgründung oder -übernahme die Möglichkeit, die BU-Rente ohne neue Gesundheitsprüfung deutlich zu erhöhen.
Der beste Zeitpunkt ist in vielen Fällen: jetzt, in der Assistenz- oder frühen Angestelltenzeit – nicht erst nach der Niederlassung.
2. Ausgangslage: Versorgung über das zahnärztliche Versorgungswerk
2.1 Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk
Zahnärztinnen und Zahnärzte sind in aller Regel Pflichtmitglieder des berufsständischen Versorgungswerks ihres Kammerbereichs. Dieses übernimmt die Rolle der gesetzlichen Rentenversicherung und bietet u. a.:
- Altersrenten
- Hinterbliebenenversorgung
- Leistungen bei Berufsunfähigkeit bzw. Invalidität
Die Beiträge werden – sofern angestellt – ähnlich wie in der gesetzlichen Rentenversicherung hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen; Selbstständige tragen den Beitrag vollständig selbst.
2.2 Die strenge Definition von Berufsunfähigkeit im Versorgungswerk
Die Versorgungswerke zahlen typischerweise erst eine Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätsrente, wenn die zahnärztliche Tätigkeit vollständig und dauerhaft nicht mehr ausgeübt werden kann. In vielen Satzungen ist zusätzlich vorgesehen, dass geprüft wird, ob eine andere ärztliche oder zahnärztliche Tätigkeit noch zumutbar wäre – etwa in Verwaltung, Wissenschaft, Lehre oder Gutachtertätigkeit.
Praktisch bedeutet das: Selbst wenn Arbeiten am Behandlungsstuhl nicht mehr möglich sind, kann das Versorgungswerk argumentieren, dass eine andere, an die zahnärztliche Ausbildung anknüpfende Tätigkeit noch ausgeübt werden kann – und dann keine Invaliditätsrente zahlen.
2.3 Warum die Versorgungslücke besonders groß ist
Zahnärzte verdienen – je nach Karrierephase – überdurchschnittlich gut. Die Invaliditätsrenten der Versorgungswerke sind demgegenüber häufig deutlich niedriger und decken meist nur einen Teil des bisherigen Lebensstandards. Gleichzeitig fehlt eine Leistung bei „teilweiser“ Berufsunfähigkeit, beispielsweise wenn:
- die Tätigkeit am Behandlungsstuhl nicht mehr möglich ist,
- aber eine administrative oder gutachterliche Tätigkeit noch denkbar wäre.
Genau hier setzt die private BU an: Sie kann bereits leisten, wenn die konkret ausgeübte Tätigkeit als Zahnarzt zu mindestens 50 % nicht mehr möglich ist – auch dann, wenn das Versorgungswerk noch keine Rente zahlt.
Versorgungswerk & private BU aufeinander abstimmen
Möchten Sie wissen, wie groß Ihre individuelle Versorgungslücke im Vergleich zu Ihrem Versorgungswerk ist?
Gespräch zur Versorgungslücke vereinbaren3. Spezifische Berufsrisiken von Zahnärzten
3.1 Körperliche Belastung und Feinmotorik
Die Arbeit am Behandlungsstuhl ist körperlich anspruchsvoll: Zwangshaltungen, langes Sitzen und Stehen, Überkopfarbeit, präzise Handbewegungen in einem sehr kleinen Arbeitsfeld. Häufige Problemfelder sind:
- Rücken- und Nackenbeschwerden
- Schulter- und Armprobleme
- Probleme mit den Händen (z. B. Arthrose, Sehnenscheidenentzündungen)
Schon relativ „kleine“ Einschränkungen können dazu führen, dass bestimmte Behandlungen nicht mehr sicher und wirtschaftlich durchgeführt werden können – insbesondere in chirurgischen Bereichen, Implantologie oder Endodontie.
3.2 Sinnesorgane: Sehen, Hören, Tastsinn
Exaktes Sehen und ein fein ausgeprägter Tastsinn sind Kernvoraussetzungen für die zahnärztliche Tätigkeit. Einschränkungen durch:
- Verlust räumlichen Sehens oder erhebliche Sehverschlechterung,
- Störungen des Tastsinns (z. B. Nervenschäden an der Hand),
- massive Hörprobleme in der Kommunikation mit Patienten und Team,
können rasch dazu führen, dass die praktischen Tätigkeiten am Patienten nicht mehr verantwortbar sind.
3.3 Infektionsrisiken und Tätigkeitsverbote
Zahnärzte arbeiten regelmäßig in einem Umfeld mit Aerosolen, Blut und Speichel. Bestimmte Infektionen oder Erkrankungen können aus Gründen des Infektionsschutzes dazu führen, dass die Tätigkeit am Patienten (zeitweise oder dauerhaft) untersagt wird – obwohl der oder die Betroffene sich subjektiv noch „arbeitsfähig“ fühlt.
Solche Konstellationen sind ein zentraler Grund dafür, warum eine sauber formulierte Infektionsklausel in der BU für Zahnärzte besonders wichtig ist.
3.4 Psychische Belastung
Zeitdruck, wirtschaftlicher Druck, hohe Verantwortung, Patienten mit Behandlungsangst, Teamführung und Personalengpässe – all das kann zu psychischen Erkrankungen beitragen. In der Gesamtbevölkerung zählen psychische Erkrankungen mittlerweile zu den häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit.
Eine BU-Lösung, die psychische Erkrankungen einschränkt oder mit Ausschlüssen arbeitet, ist für Zahnärzte daher besonders kritisch.
4. Wie eine gute BU für Zahnärzte aufgebaut sein sollte
4.1 Schutz der „zuletzt konkret ausgeübten Tätigkeit“
Eine hochwertige BU sichert immer die zuletzt konkret ausgeübte Tätigkeit ab – nicht irgendeine theoretisch denkbare Tätigkeit als Zahnarzt. Entscheidend ist:
- Wie wird die Tätigkeit im Antrag beschrieben?
- Spiegelt diese Beschreibung den tatsächlichen Arbeitsalltag wider?
Wer z. B. überwiegend chirurgisch/implantologisch tätig ist oder als Kieferorthopädin arbeitet, sollte das so konkret wie möglich angeben. Zu allgemeine Formulierungen („Tätigkeit als Zahnarzt“) können im Leistungsfall Spielraum für Diskussionen eröffnen.
4.2 Verzicht auf abstrakte Verweisung
Von „abstrakter Verweisung“ spricht man, wenn der Versicherer auf einen anderen Beruf verweisen darf, den die versicherte Person theoretisch noch ausüben könnte – unabhängig davon, ob sie einen solchen Beruf tatsächlich ergreifen würde.
Für Zahnärzte wäre das etwa eine Verweisung auf Tätigkeiten in:
- Verwaltung oder Management
- Wissenschaft und Forschung
- Gutachter- oder Beratungstätigkeiten
Gute BU-Tarife für Zahnärzte verzichten vertraglich auf diese abstrakte Verweisung. Maßstab ist dann die konkret ausgeübte zahnärztliche Tätigkeit.
4.3 Die Infektionsklausel im Detail
Für Zahnärzte kann eine Infektionsklausel den entscheidenden Unterschied machen. Wichtige Punkte:
- Gleichstellung von Tätigkeitsverbot und Berufsunfähigkeit: Die Klausel sollte vorsehen, dass ein behördliches oder gesetzliches Tätigkeitsverbot (z. B. wegen einer Infektion) einer Berufsunfähigkeit gleichgestellt wird.
- Teilverbote: Idealerweise ist auch ein Verbot, am Patienten zu arbeiten, bereits ausreichend, wenn der Kern der Tätigkeit wegfällt.
- Offene Formulierung: Eine offene Formulierung („bestimmte übertragbare Krankheiten“) ist oft flexibler als eine starre Liste einzelner Erreger.
Zahnärzte sollten die entsprechende Klausel im Bedingungswerk genau prüfen (lassen) – hier unterscheiden sich die Tarife teils deutlich.
4.4 Die Umorganisationsklausel für Praxisinhaber
Bei selbständigen Zahnärzten mit eigener Praxis prüfen manche Versicherer im Leistungsfall, ob eine „zumutbare Umorganisation“ der Praxis dazu führen könnte, dass der Zahnarzt trotz gesundheitlicher Einschränkungen weiterhin in relevantem Umfang tätig sein kann.
Typische Beispiele wären:
- Einstellung weiterer angestellter Zahnärzte, denen operative Tätigkeiten übertragen werden
- Verlagerung der eigenen Tätigkeit auf Beratung, Diagnostik oder Verwaltung
- Umstellung des Behandlungsspektrums
Eine faire Umorganisationsklausel berücksichtigt:
- die wirtschaftliche Zumutbarkeit (Investitionen, Personalkosten),
- den Erhalt des fachlichen Status (kein Zwang zu deutlicher „Dequalifizierung“),
- die Situation der Praxis (Größe, Struktur, Patientenstamm).
Für Praxisinhaber lohnt sich ein besonders genauer Blick auf diesen Passus – im Zweifel mit fachkundiger Unterstützung.
4.5 Psyche, Rücken & Vorerkrankungen – keine versteckten Ausschlüsse
Zahnärzte sind sowohl körperlich als auch psychisch stark belastet. Umso wichtiger ist es, dass:
- psychische Erkrankungen nicht generell ausgeschlossen oder nur stark eingeschränkt versichert sind,
- es keine pauschalen Ausschlüsse ganzer Organsysteme (z. B. „Wirbelsäule und Bandscheiben“) gibt, sofern dies gesundheitlich vermeidbar ist.
Vorerkrankungen können zu individuellen Ausschlüssen oder Zuschlägen führen. Je früher der Abschluss, desto höher ist die Chance auf einen weitgehend „sauberen“ Versicherungsschutz.
4.6 Nachversicherung, Dynamik und weitere Optionsrechte
Kaum ein Zahnarzt weiß bei Berufseintritt, wie hoch das Einkommen in 10 oder 20 Jahren sein wird. Gute BU-Verträge bieten deshalb:
- Nachversicherungsgarantien bei bestimmten Ereignissen (z. B. Approbation, Abschluss der Weiterbildung, Heirat, Geburt eines Kindes, Einkommenssteigerung),
- Berufsspezifische Anlässe wie Praxisgründung oder -übernahme,
- Beitrags- und Leistungsdynamik, um die Rente regelmäßig an Inflation und Einkommensentwicklung anzupassen.
Viele hochwertige Tarife erlauben es, bei Praxisgründung oder -übernahme die BU-Rente ohne neue Gesundheitsprüfung um z. B. 500–1.000 Euro pro Monat zu erhöhen. Ein angestellter Zahnarzt, der früh mit 1.500 Euro BU-Rente beginnt, kann so bei Niederlassung auf 2.500–3.000 Euro erhöhen – ohne dass die zwischenzeitliche Gesundheitshistorie erneut geprüft wird.
BU-Konzept für Assistenzzahnärzte, Angestellte und Praxisinhaber
Ob Sie noch in der Weiterbildung sind oder bereits eine Praxis führen: Die BU sollte zu Ihrer aktuellen und künftigen beruflichen Situation passen.
Individuelles BU-Konzept anfordern5. Wie hoch sollte die BU-Rente für Zahnärzte sein?
5.1 Orientierungsgröße: Netto-Einkommen plus Vorsorgeanteil
Eine häufig genutzte Faustregel lautet: BU-Rente etwa 60–80 % des heutigen Nettoeinkommens inklusive des Anteils, der heute für die Altersvorsorge verwendet wird.
Hintergrund:
- Das Nettoeinkommen fällt im BU-Fall weitgehend weg.
- Beiträge zum Versorgungswerk und zu privater Altersvorsorge können meist nicht im bisherigen Umfang fortgeführt werden.
- Aus der BU-Rente müssen weiterhin Steuern und Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge bezahlt werden.
5.2 Beispiele und einfache Faustformel-Tabelle
Die folgenden Beispiele sind bewusst vereinfacht und dienen nur der Orientierung. Individuelle Steuersätze und Lebenssituationen können abweichen.
| Ausgangssituation | Brutto / Überschuss | Realistisches Netto (ca.) | Empfohlene BU-Rente (Spanne) |
|---|---|---|---|
| Angestellter Zahnarzt, frühe Berufsjahre | 6.500 € brutto / Monat | 3.500–3.700 € | 2.000–2.500 € |
| Erfahrener angestellter Zahnarzt / Oberarzt | 8.500 € brutto / Monat | 4.500–4.800 € | 2.800–3.500 € |
| Niedergelassener Zahnarzt, Praxisüberschuss | 250.000 € / Jahr (≈ 20.800 €/Monat) |
nach Steuern, Vorsorge und Praxisstruktur z. B. 8.000–9.000 € verfügbares Privatbudget | 4.000–6.000 € (private BU-Rente) |
Die konkrete Zielgröße sollte immer auf Basis der eigenen Haushaltsrechnung und langfristigen Lebensplanung ermittelt werden.
5.3 Laufzeit und Endalter
In vielen Fällen ist ein BU-Endalter von 65 bis 67 Jahren sinnvoll, also in etwa bis zur regulären Altersrente. Ein zu niedriges Endalter (z. B. 60) birgt das Risiko einer Versorgungslücke in den Jahren bis zur Altersrente – also genau in einer Phase, in der Rücklagen ggf. schon teilweise aufgebraucht sind.
5.4 Spezialfall: BU in der Weiterbildung und Fachzahnarztzeit
Viele Assistenzzahnärztinnen und -zahnärzte denken: „Ich verdiene aktuell noch nicht so viel, eine hohe BU-Rente lohnt später mehr.“ Dieser Gedanke greift zu kurz, denn:
- Entscheidend für die Versicherbarkeit ist primär der Gesundheitszustand, nicht das aktuelle Einkommen.
- Eine moderate BU-Rente in der Assistenzzeit „konserviert“ die aktuelle Gesundheitsakte – also meist mit weniger Vorerkrankungen oder Befunden.
- Später können über Nachversicherungsgarantien bei Fachzahnarzttitel, Einkommenssprung oder Praxisgründung sinnvolle Rentenerhöhungen erfolgen.
Aus strategischer Sicht ist es daher oft klüger, früh zu beginnen – selbst mit einer etwas niedrigeren Rente – als viele Jahre abzuwarten und dann mit einer komplexen Gesundheitshistorie konfrontiert zu sein.
6. Praxisinhaber: BU und Praxisausfall sinnvoll kombinieren
Für Praxisinhaber stellt sich nicht nur die Frage nach dem privaten Einkommen, sondern auch nach der Finanzierung der laufenden Praxisfixkosten bei Krankheit oder Unfall. Hier ist die Kombination aus privater BU und Praxisausfallversicherung üblich.
| Private BU | Praxisausfallversicherung | |
|---|---|---|
| Zweck | Sicherung des privaten Lebensunterhalts | Deckung der laufenden Praxisfixkosten |
| Auslöser | Berufsunfähigkeit (i. d. R. ab 50 % in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit) | vorübergehende Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall |
| Laufzeit | bis Endalter (z. B. 65–67 Jahre) | meist kürzere Leistungszeiten, oft mit Karenzzeiten |
| Adressat | Privatperson | Praxis (Betrieb) |
Die private BU ersetzt nicht die Praxisausfallversicherung – und umgekehrt. Beide Bausteine erfüllen unterschiedliche Funktionen und sollten bei Praxisgründung gemeinsam durchdacht werden.
Praxisgründung geplant oder bereits erfolgt?
Lassen Sie prüfen, wie private BU und Praxisausfallversicherung in Ihrem Fall optimal zusammenspielen können.
Termin zur Praxisabsicherung vereinbaren7. Die Gesundheitsprüfung – Vorbereitung statt Schnellschuss
7.1 Was Versicherer wissen wollen
Vor Abschluss einer BU stellen Versicherer detaillierte Gesundheitsfragen. Typischerweise abgefragt werden:
- Ärztliche und zahnärztliche Behandlungen in den letzten Jahren (z. B. 3–10 Jahre, je nach Bereich)
- Diagnosen, Beschwerden, Operationen und Krankenhausaufenthalte
- Psychische Beschwerden oder Behandlungen (z. B. Depression, Burn-out, Angststörungen)
- Unfälle, orthopädische Probleme, chronische Erkrankungen
- Medikamenteneinnahmen
Wichtiger Hinweis zu Gesundheitsfragen
Gesundheitsfragen müssen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet werden. Unvollständige oder bewusst verharmlosende Angaben können im Leistungsfall dazu führen, dass der Versicherer den Vertrag anficht oder die Leistung verweigert. Im Zweifel ist es besser, einen Sachverhalt zu viel als einen zu wenig zu melden.
7.2 Wie Zahnärzte sich vorbereiten sollten
Sinnvoll ist es, vor der Antragstellung die eigene Gesundheitsakte strukturiert aufzubereiten:
- Ausdruck der Patientendaten bzw. Diagnosen vom Hausarzt und relevanten Fachärzten
- Übersicht über stationäre Aufenthalte, Operationen und längere Krankheitsphasen
- Notizen zu Art, Dauer und Verlauf psychischer oder orthopädischer Beschwerden
So lassen sich die Gesundheitsfragen sauber und nachvollziehbar beantworten – ohne langes Rätselraten, was „damals“ genau dokumentiert wurde.
7.3 Anonyme Risikovoranfrage
Bei relevanten Vorerkrankungen (z. B. längere psychotherapeutische Behandlung, chronische orthopädische Probleme, schwere Unfälle) bietet sich häufig eine anonyme Risikovoranfrage über einen spezialisierten Berater an. Dabei werden:
- die Gesundheitsdaten ohne Namensnennung an mehrere Versicherer übermittelt,
- die voraussichtliche Annahmeentscheidung (Normalannahme, Zuschlag, Ausschluss, Ablehnung) abgefragt,
- erst auf Basis der Rückmeldungen ein konkreter Antrag bei einem ausgewählten Versicherer gestellt.
Vorteil: Man vermeidet unnötige Ablehnungen im zentralen Hinweis- und Informationssystem der Versicherer und gewinnt Transparenz, welcher Versicherer mit der eigenen Gesundheitsakte am besten umgehen kann.
8. Steuerliche Einordnung (kurz & praxisnah)
Die genaue steuerliche Behandlung einer BU-Rente hängt von der Vertragsgestaltung ab (z. B. privat abgeschlossen, im Rahmen einer Basisrente oder betrieblichen Altersversorgung). Grundsätzlich gilt:
- BU-Renten unterliegen in der Regel der Einkommensteuer.
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind aus der BU-Rente zu zahlen.
- Die steuerliche Belastung kann im Einzelfall deutlich niedriger sein als beim bisherigen Erwerbseinkommen, bleibt aber relevant.
Für die konkrete Gestaltung ist eine individuelle steuerliche Beratung sinnvoll. Wichtig ist vor allem, die BU-Rente so zu bemessen, dass auch nach Steuern und Sozialabgaben der Lebensunterhalt realistisch gesichert ist.
9. Typische Fehler und wie Zahnärzte sie vermeiden
- Zu spätes Kümmern: Warten bis zur Praxisgründung führt oft dazu, dass bereits relevante Vorerkrankungen bestehen.
- Zu niedrige BU-Rente / zu kurzes Endalter: Eine zu knapp kalkulierte Rente oder ein Endalter von z. B. 60 kann im Ernstfall nicht reichen.
- Unzureichende Bedingungen: Kein Verzicht auf abstrakte Verweisung, schwache Infektionsklausel oder problematische Umorganisationsklausel.
- Eingeschränkter Schutz bei Psyche und Rücken: Ausschlüsse oder starke Einschränkungen in diesen Bereichen sind für Zahnärzte besonders kritisch.
- Unvollständige Gesundheitsangaben: „Wird schon passen“ rächt sich häufig im Leistungsfall.
10. Zusammenfassung & Checkliste für Zahnärzte
10.1 Kurzfazit
Das Versorgungswerk bietet nur eine Basisabsicherung bei sehr strenger Definition der Berufsunfähigkeit. Für Zahnärztinnen und Zahnärzte mit hochspezialisierter, körperlich und psychisch anspruchsvoller Tätigkeit ist eine private BU daher ein zentraler Baustein der Existenzsicherung. Wer frühzeitig – idealerweise in der Assistenz- oder frühen Angestelltenzeit – mit einer gut strukturierten BU beginnt und Nachversicherungsgarantien nutzt, sichert seine Gesundheitshistorie und schafft sich Gestaltungsspielraum für spätere Einkommenssprünge. Entscheidend sind dabei nicht nur die Beitragshöhe, sondern vor allem die Qualität der Bedingungen und eine saubere Gesundheitsdokumentation.
10.2 Checkliste: „BU für Zahnärzte prüfen“
- [ ] Leistet der Vertrag ab mindestens 50 % Berufsunfähigkeit in meiner konkret ausgeübten Tätigkeit als Zahnarzt/Zahnärztin?
- [ ] Gibt es einen Verzicht auf abstrakte Verweisung auf andere Berufe oder Tätigkeiten?
- [ ] Enthält der Vertrag eine Infektionsklausel, die auch Tätigkeitsverbote am Patienten ausreichend berücksichtigt?
- [ ] Ist die Umorganisationsklausel für Praxisinhaber klar und wirtschaftlich zumutbar formuliert?
- [ ] Sind psychische Erkrankungen und Rücken/Bewegungsapparat ohne pauschale Ausschlüsse mitversichert (soweit gesundheitlich möglich)?
- [ ] Passt die BU-Rente (60–80 % meines Netto inkl. Vorsorge) zu meinem aktuellen Lebensstandard und meinen Verpflichtungen?
- [ ] Läuft der Vertrag bis zu einem sinnvollen Endalter (z. B. 65–67 Jahre)?
- [ ] Nutzt mein Vertrag Nachversicherungsgarantien (Approbation, Fachzahnarzt, Praxisgründung, Familie) ohne neue Gesundheitsprüfung?
- [ ] Habe ich die Gesundheitsfragen vollständig und nachvollziehbar beantwortet – idealerweise nach Sichtung meiner medizinischen Unterlagen?
Checkliste gemeinsam durchgehen
Gerne können Sie die Punkte der Checkliste in einem strukturierten Gespräch mit einem spezialisierten Berater durchgehen.
Jetzt Termin buchen
