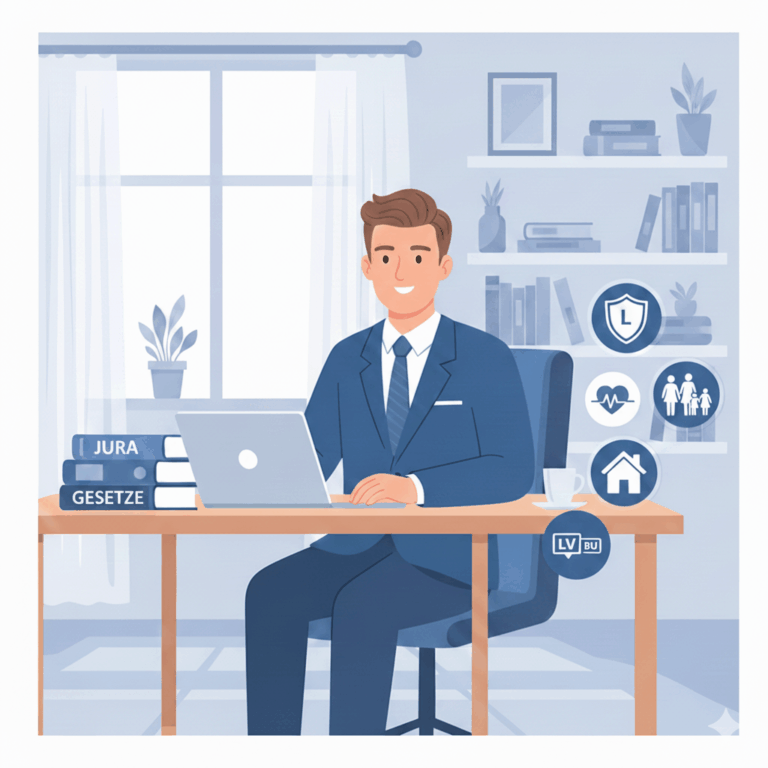
Angestellte Anwälte: Welche Versicherungen brauchen sie wirklich?
Angestellte Rechtsanwälte haben eine besondere Ausgangslage: Sie erzielen ein gutes Einkommen, stehen unter hohem fachlichen Druck und tragen häufig Verantwortung für Familie und Haus. Gleichzeitig sind sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern im anwaltlichen Versorgungswerk organisiert. Genau deshalb braucht es eine eigene, gut durchdachte Versicherungsstrategie.
In diesem Leitfaden erfährst du Schritt für Schritt, welche Versicherungen du als angestellter Anwalt wirklich brauchst, welche du zusätzlich prüfen solltest und worauf es in der Praxis ankommt – vom BU-Konzept über die Kinderabsicherung bis hin zur Altersvorsorge.
In 60 Sekunden: Was du wirklich brauchst
- Arbeitskraft absichern: Private BU mit Zwei-Vertragslösung aufbauen – Ziel: insgesamt 70–80 % deines Netto-Einkommens plus späterer PKV-Beitrag.
- Familieneinkommen schützen: Risiko-Lebensversicherung für dich (Kredit + Familie) und für deine Ehefrau (Teilzeit-Einkommen und Care-Arbeit).
- Krankenversicherung planen: Heute GKV mit sinnvollen Zusatztarifen nutzen und zusätzlich einen Optionstarif, um den späteren Wechsel in die PKV abzusichern.
- Kinder absichern: Invaliditäts- und Kinder-Unfallversicherung mit hoher Invaliditätssumme, Progression und ggf. Unfallrente – als Ergänzung zu eurer eigenen BU.
- Haus & Haftung sichern: Wohngebäude-, Hausrat- und Glasversicherung prüfen sowie eine starke Privathaftpflicht und eine passende Rechtsschutzversicherung einrichten.
- Reisen absichern: Familien-Auslandsreisekrankenversicherung und kombinierter Reiserücktritt- und Reiseabbruchschutz für eure Urlaube.
- Altersvorsorge auf mehrere Standbeine stellen: Versorgungswerk mit Basisrente, bAV und privater fondsgebundener Vorsorge mit ETF-Anlagemotor kombinieren.
1. Besonderheiten angestellter Anwälte
Als angestellter Anwalt befindest du dich in einer typischen „Sandwich-Position“: Auf der einen Seite stehen fachliche Verantwortung, Deadlines und Mandanten, auf der anderen Seite Familie, Hauskredit und das Bedürfnis nach einem stabilen Alltag. Hinzu kommt, dass du nicht in die gesetzliche Rentenversicherung, sondern in das Versorgungswerk deines Berufsstands einzahlst.
Viele Standard-Ratgeber für „Normalangestellte“ blenden diese Besonderheiten aus. Deshalb solltest du deine Versicherungs- und Vorsorgefragen nicht nach generischen Checklisten angehen, sondern konsequent an deiner Situation als angestellter Anwalt mit Versorgungswerk und Karriereperspektive ausrichten.
2. Arbeitskraft absichern: Versorgungswerk & private BU
2.1 Warum deine Arbeitskraft dein größtes Vermögen ist
Dein zukünftiges Einkommen über die nächsten Jahrzehnte ist der mit Abstand wichtigste Vermögenswert deiner Familie. Kreditraten, Kita-Gebühren, Lebenshaltung und Altersvorsorge hängen direkt daran, dass du als Anwalt weiterarbeiten kannst. Fällt diese Einkommensquelle dauerhaft weg, reicht die Basisabsicherung des Versorgungswerks in aller Regel nicht aus, um euren Lebensstandard und das Eigenheim zu halten.
2.2 Was leistet das Versorgungswerk bei Berufsunfähigkeit?
Das anwaltliche Versorgungswerk bietet eine Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsminderungsrente. Typischerweise gelten dabei folgende Grundsätze:
- Die Leistungshöhe orientiert sich an deinen eingezahlten Beiträgen und an der jeweiligen Satzung.
- Die Hürde für eine Leistung ist vergleichsweise hoch, da oft deine Erwerbsfähigkeit im Berufsbild insgesamt betrachtet wird.
- In vielen Satzungen wird geprüft, ob du noch in irgendeiner Form als Anwalt tätig sein kannst, nicht nur in deiner aktuellen Funktion.
- Psychische Erkrankungen und Burnout können zwar versichert sein, jedoch ist die Anerkennung häufig mit erheblichem Aufwand verbunden.
Gerade mit Mitte 30 und erst wenigen Beitragsjahren ergibt sich daraus meist eine BU-Rente, die spürbar unter deinem aktuellen Nettoeinkommen liegt. Somit entsteht eine Lücke, die du aktiv schließen musst.
2.3 Rolle der privaten BU – Ziel: 70–80 % Netto plus PKV-Beitrag
Die private Berufsunfähigkeitsversicherung ergänzt das Versorgungswerk und soll genau diese Einkommenslücke schließen. Besonders sinnvoll ist ein Zielniveau von etwa 70–80 % deines aktuellen Nettoeinkommens. Außerdem solltest du – insbesondere wenn der Wechsel in die PKV geplant ist – den späteren PKV-Beitrag in die Höhe der BU-Rente einkalkulieren.
So erreichst du eine Gesamtsituation, in der Versorgungswerk, private BU-Rente und ggf. Krankentagegeld zusammen ausreichen, um Hauskredit, Familienkosten und eine vorsichtige Altersvorsorge weiter zu bedienen.
2.4 Die Zwei-Vertragslösung in der BU
Anstatt einen einzigen großen BU-Vertrag abzuschließen, kannst du deine Absicherung bewusst auf zwei getrennte Verträge bei unterschiedlichen Versicherern verteilen. Dadurch entsteht mehr Flexibilität, und du nutzt die Spielräume der Bedingungen besser aus.
Typischer Aufbau:
- Vertrag A: Basisvertrag, der die aktuelle Versorgungslücke abdeckt.
- Vertrag B: Ausbauvertrag, der zukünftige Gehaltssprünge und den späteren PKV-Beitrag abbildet.
Vorteile der Zwei-Vertragslösung
- Umgehung ärztlicher Untersuchungsgrenzen: Hohe BU-Renten lösen bei vielen Versicherern ärztliche Untersuchungen aus. Zwei etwas kleinere Verträge können unterhalb dieser Grenzen bleiben.
- Doppelte Nachversicherungsoptionen: Lebensereignisse wie Gehaltssprünge, Geburt von Kindern, Erwerb eines Hauses oder der Schritt zum Partner lassen sich bei beiden Verträgen nutzen. So ist eine schnellere und höhere Steigerung der BU-Rente möglich – im Rahmen der jeweiligen Bedingungen auch ohne erneute Gesundheitsprüfung.
- Risikostreuung: Im Leistungsfall werden zwei Gesellschaften geprüft. Zahlt ein Versicherer schneller, während der andere noch prüft, verschafft dir das zusätzliche Sicherheit.
Nachteile der Zwei-Vertragslösung
- Mehr Verwaltungsaufwand: Zwei Verträge müssen beantragt, angepasst, überwacht und im Leistungsfall separat geltend gemacht werden.
- Teilweise höhere Gesamtkosten: In Summe kann die Kombination geringfügig teurer sein als ein großer Vertrag.
- Verteilung auf mehrere Anbieter: Die komplette BU-Rente liegt nicht bei einem einzigen „Wunschversicherer“, sondern verteilt sich auf zwei Gesellschaften.
Die Zwei-Vertragslösung ist kein Muss, aber für angestellte Anwälte mit steigendem Einkommen und Partnerperspektive ein sehr praxisnahes Werkzeug, um Gesundheitsprüfungen zu entlasten und Nachversicherungsoptionen optimal zu nutzen.
2.5 Versorgungswerk vs. private BU im Vergleich
| Merkmal | Versorgungswerk | Private BU | Konsequenz für angestellte Anwälte |
|---|---|---|---|
| Definition der BU | Strenge Kriterien, häufig Betrachtung der Erwerbsfähigkeit im Berufsfeld insgesamt. | Berufsbild-orientiert, 50 % BU im zuletzt ausgeübten Beruf. | Die private BU ergänzt das Versorgungswerk um eine passgenaue Absicherung des konkreten Berufsbildes. |
| Höhe der Leistung | Abhängig von Beitragsjahren, bei jungen Anwälten meist deutlich niedriger als das aktuelle Nettoeinkommen. | Individuell wählbar, z. B. 70–80 % des Netto-Einkommens. | Das Versorgungswerk ist Sockel; die private BU schließt die Lücke zum benötigten Einkommen. |
| Flexibilität | Relativ starr, Änderungen nur über Beiträge und Satzungsregelungen. | Nachversicherung, Dynamik, Zwei-Vertragslösung und Anpassung an Lebensereignisse möglich. | Mit der privaten BU kann die Absicherung an Karriere, Familienplanung und PKV-Wechsel angepasst werden. |
| Gesundheitsprüfung | Zu Beginn des Berufslebens, später kaum beeinflussbar. | Bei Abschluss einmalig, Nachversicherung oft ohne neue Gesundheitsprüfung möglich. | Früher Einstieg in die BU ist strategisch besonders wertvoll – insbesondere bei guter Gesundheit. |
2.6 Krankentagegeld: Lücke nach der Lohnfortzahlung schließen
Nach sechs Wochen endet die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers. Anschließend zahlt die gesetzliche Krankenversicherung Krankengeld, das spürbar unter deinem bisherigen Nettoeinkommen liegt. Mit zunehmender Gehaltshöhe wird diese Differenz immer relevanter.
Ein ergänzendes Krankentagegeld sorgt deshalb dafür, dass du auch bei längerer Krankheit deine laufenden Kosten und deinen Lebensstandard finanzieren kannst. In der PKV gehört ein Krankentagegeldtarif in der Regel zum Standardaufbau der Absicherung.
3. BU für den Ehepartner: Teilzeit heißt nicht „unwichtig“
Auch wenn deine Ehefrau „nur“ in Teilzeit arbeitet, trägt ihr Einkommen spürbar zum Haushaltsbudget bei. Zusätzlich ist ihre Care-Arbeit – also Kinderbetreuung und Haushalt – wirtschaftlich kaum zu ersetzen. Fällt sie längerfristig aus, müsstest du entweder selbst beruflich zurückstecken oder umfangreiche Fremdbetreuung und Unterstützung einkaufen.
3.1 Warum eine BU für die Ehefrau sinnvoll ist
- Ihr Teilzeit-Einkommen fällt weg und muss dauerhaft ersetzt werden.
- Mehr Kinderbetreuung oder Haushaltshilfe verursacht zusätzliche, laufende Kosten.
- Dein ohnehin hoher Workload in der Kanzlei lässt sich nur begrenzt reduzieren.
3.2 Die Teilzeitklausel – worauf es ankommt
Bei einer BU für Teilzeitkräfte sind die Bedingungen entscheidend. Gute Verträge stellen ausdrücklich auf die zuletzt konkret ausgeübte Tätigkeit ab – und zwar in ihrem realen Umfang sowie mit ihren geistigen, organisatorischen und körperlichen Anforderungen.
Problematisch sind hingegen Formulierungen, die eine spätere Stundenreduktion zu deinem Nachteil auslegen oder eine Verweisung auf nahezu beliebige leichtere Teilzeittätigkeiten zulassen. Gerade bei Müttern mit wechselnden Arbeitszeitmodellen ist das ein wichtiger Prüfpunkt.
3.3 Checkliste: Gute BU-Bedingungen für Teilzeitkräfte
- Die zuletzt ausgeübte Tätigkeit ist der klare Referenzpunkt für die Prüfung der BU.
- Elternzeit oder vorübergehende Teilzeit werden nicht zu deinen Lasten ausgelegt.
- Die BU-Rente deckt sowohl den Einkommensersatz als auch zusätzlichen Betreuungsbedarf ab.
- Nachversicherung ist möglich, wenn deine Ehefrau später die Stundenzahl erhöht oder in Vollzeit wechselt.
4. Todesfall- & Familienabsicherung: Risiko-Lebensversicherung
4.1 Was ohne Risiko-LV passieren kann
Verstirbt der Hauptverdiener, fehlen Einkommen und Tilgungskraft für das Haus von einem Tag auf den anderen. Neben der emotionalen Belastung drohen dann schnell finanzielle Einschnitte bis hin zur Notwendigkeit, das Eigenheim zu verkaufen. Genau hier greift eine Risiko-Lebensversicherung und sorgt dafür, dass deine Familie finanziell handlungsfähig bleibt.
4.2 Risiko-LV für den Anwalt
Wichtige Eckpunkte sind:
- Absicherung mindestens in Höhe der Restschuld des Kredits,
- Zusatzbetrag für mehrere Jahre Lebenshaltungskosten und Ausbildung der Kinder,
- Laufzeit bis zum voraussichtlichen Ende der größten Verpflichtungen (z. B. bis die Kinder wirtschaftlich eigenständig sind).
4.3 Risiko-LV für die Ehefrau
Auch der Tod der Ehefrau hätte massive finanzielle Folgen. In diesem Fall würden Kinderbetreuung und Haushalt neu organisiert werden müssen, während du deine Arbeitsbelastung nicht beliebig reduzieren kannst. Eine eigene Risiko-LV für deine Frau kann genau diese Mehrbelastung abfedern.
5. Krankenversicherung: GKV, PKV & Optionstarif
5.1 GKV vs. PKV – strategische Weichenstellung
Als angestellter Anwalt liegst du regelmäßig oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze und kannst daher zwischen GKV und PKV wählen. Diese Entscheidung wirkt sich über Jahrzehnte auf deine Beiträge, deine Leistungen und deine Planbarkeit aus, sodass sie gut vorbereitet werden sollte.
5.2 Optionstarif: Heute absichern, was du morgen brauchst
Ein Optionstarif ist ein Baustein eines privaten Krankenversicherers, der dir das Recht einräumt, später in einen Volltarif zu wechseln oder Leistungen auszubauen – häufig ohne erneute Gesundheitsprüfung oder zumindest mit deutlich reduzierter Prüfung.
Das lohnt sich vor allem dann, wenn du aktuell in der GKV bleibst, aber mittel- oder langfristig einen Wechsel in die PKV für realistisch hältst. Durch den Optionstarif sicherst du dir künftige Gestaltungsmöglichkeiten, obwohl du sie heute noch nicht nutzen möchtest.
5.3 GKV mit sinnvollen Zusatzversicherungen
- Zahnzusatzversicherung: Bessere Erstattung bei Zahnersatz und hochwertigen Füllungen.
- Stationäre Zusatzversicherung: Einbettzimmer und Chefarztbehandlung als Komfort-Upgrade im Krankenhaus.
- Ambulante Zusatztarife: Erweiterte Leistungen bei Sehhilfen, Heilpraktiker-Behandlungen oder besonderen Vorsorgeuntersuchungen.
5.4 PKV-Tarifwahl für Anwälte
Wenn du dich für einen Wechsel in die PKV entscheidest, solltest du besonders auf folgende Punkte achten:
- Leistungen bei psychischen Erkrankungen und für längere Reha-Phasen sind ausreichend und klar geregelt.
- Die Beitragskalkulation ist nachvollziehbar, und Selbstbehalte sind sinnvoll ausgestaltet.
- Hilfsmittel, Arzneimittel und ambulante Behandlungen werden nicht zu stark eingeschränkt.
6. Kinderabsicherung: Invalidität & Unfall
6.1 Kinder-Invaliditätsversicherung
Kinder können keine klassische BU abschließen. Stattdessen kommt eine Kinder-Invaliditätsversicherung in Betracht, die das Risiko einer dauerhaften Beeinträchtigung durch Krankheit oder Unfall absichert. Hier steht weniger ein entgehendes Einkommen im Vordergrund, sondern vor allem die Mehrkosten im Alltag.
Entscheidende Fragen sind:
- Soll eine monatliche Rente gezahlt werden, ein Kapitalbetrag oder eine Kombination daraus?
- Reicht die Höhe der Leistung aus, um Therapie, Umbauten, Hilfsmittel und eventuell eine spätere eingeschränkte Erwerbsfähigkeit zu kompensieren?
6.2 Kinder-Unfallversicherung im Detail
Eine Kinder-Unfallversicherung konzentriert sich dagegen ausschließlich auf Unfälle. Dieser Schutz kann als eigenständiger Kindertarif oder im Rahmen einer Familienunfallversicherung gestaltet werden, wobei dedizierte Kindertarife oft besser auf die Bedürfnisse junger Menschen zugeschnitten sind.
Bausteine einer guten Kinder-Unfallversicherung
- Invaliditätsgrundsumme: Ein hoher Kapitalbetrag bei unfallbedingter Invalidität, häufig im sechsstelligen Bereich.
- Progression: Überproportionale Steigerung der Leistung bei schweren Invaliditätsgraden (z. B. 300 % oder mehr), damit insbesondere gravierende Fälle finanziell gut abgefedert werden.
- Unfallrente: Eine laufende Rente ab einem bestimmten Invaliditätsgrad, die langfristige Mehrkosten im Alltag abdecken soll.
Spezielle Kinder-Klauseln
- Leistungen für Lernförderung und Nachhilfe, wenn dein Kind durch den Unfall schulisch zurückfällt.
- Zuschüsse für Reha, Hilfsmittel und behindertengerechte Umbauten.
- Erstattung kosmetischer Operationen nach entstellenden Verletzungen.
- Unterstützung bei Schul- oder Kita-Begleitung und Betreuungsleistungen.
6.3 Unterschied zur Unfallversicherung der Eltern
Die Unfallversicherung der Eltern ist vor allem eine Ergänzung zur BU der Erwachsenen. Sie stellt bei schweren Unfällen zusätzliches Kapital oder eine Unfallrente bereit, ersetzt jedoch nie die klassische BU. Für Kinder sieht die Ausgangssituation deutlich anders aus.
Während sich Erwachsenentarife eher an der Erwerbsfähigkeit orientieren, stehen bei Kindern die tatsächlichen Mehrkosten und die Entwicklung im Vordergrund. Aus diesem Grund sind eigenständige Kinder-Invaliditäts- oder Kinder-Unfalllösungen sinnvoller als eine reine Mitversicherung über die Eltern-Police.
Fazit: Eine Familienunfallversicherung mit Mitversicherung der Kinder ist besser als gar kein Schutz. Trotzdem ersetzt sie keine saubere, auf Kinder zugeschnittene Invaliditäts- oder Unfallabsicherung.
7. Sachversicherungen rund um Haus & Alltag
7.1 Wohngebäudeversicherung
Für dein Reihenhaus ist die Wohngebäudeversicherung ein Pflichtbaustein, häufig sogar direkt von der finanzierenden Bank gefordert. Sie deckt in der Grundversion Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel ab. Ohne diesen Schutz wäre der größte materielle Vermögenswert eurer Familie massiv gefährdet.
Darüber hinaus solltest du heute unbedingt prüfen, ob Elementarschäden – also zum Beispiel Starkregen, Rückstau oder Überschwemmung – eingeschlossen sind. Gerade in Regionen mit Starkregenereignissen kann dieser Baustein den Unterschied zwischen „ärgerlich“ und „existenzbedrohend“ ausmachen.
7.2 Hausratversicherung
Die Hausratversicherung schützt euer Inventar: Möbel, Elektronik, Kleidung, Spielzeug und viele Alltagsgegenstände mehr. Sie greift unter anderem bei Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasserschäden oder Sturm. Da ihr mit zwei kleinen Kindern und nur begrenzten Rücklagen lebt, wäre ein größerer Hausratsschaden ohne Versicherung schwer zu verkraften.
7.3 Glasversicherung
Glasbrüche sind nicht immer automatisch voll versichert. Relevant sind zum einen die Gebäudeverglasung (Fenster, Terrassentüren, Wintergärten) und zum anderen die Innenglas- oder Mobiliarverglasung wie Glastische, Vitrinen oder Duschkabinen.
Je nach Bauweise deines Reihenhauses kann daher eine separate Glasversicherung oder ein Glasbaustein in Wohngebäude- und Hausratvertrag sinnvoll sein. Das gilt insbesondere dann, wenn große Glasflächen oder besondere Fensterlösungen verbaut wurden, deren Austausch schnell vierstellige Beträge kostet.
7.4 Privathaftpflicht für die Familie
Die private Haftpflicht ist eine der wichtigsten und zugleich günstigsten Versicherungen überhaupt. Sie schützt euch vor Schadensersatzforderungen, wenn ihr anderen Personen einen Schaden zufügt – sei es ein Sach-, Personen- oder Vermögensschaden.
Wichtige Punkte sind eine ausreichend hohe Deckungssumme, idealerweise im zweistelligen Millionenbereich, sowie sinnvolle Klauseln:
- Miteinbezug deliktunfähiger Kinder,
- Mitversicherung von privat genutzten Schlüsseln (z. B. Haustür, Kanzleischlüssel),
- Deckung von Gefälligkeitsschäden, soweit möglich.
7.5 Rechtsschutzversicherung
Auch als Jurist bist du in eigener Sache nicht automatisch dein bester Anwalt. Eine Rechtsschutzversicherung nimmt dir das Kostenrisiko, wenn du eigene Ansprüche durchsetzen möchtest – etwa im Mietrecht, Vertragsrecht oder im Arbeitsverhältnis mit der Kanzlei.
7.6 Überblick: Sach- und Haftpflichtversicherungen
| Risiko | Notwendigkeit | Typische Versicherung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Schäden am Eigenheim | Muss | Wohngebäudeversicherung | Schützt euren größten Vermögenswert und wird häufig von der Bank gefordert. |
| Beschädigung/Verlust Hausrat | Sollte | Hausratversicherung | Mit Familie und wenig Rücklagen sehr wichtig, um nicht bei null anfangen zu müssen. |
| Glasschäden | Sollte | Glasbaustein oder Glasversicherung | Sinnvoll bei großen Glasflächen und hochwertigen Fensterlösungen. |
| Haftpflichtschäden im Privatleben | Muss | Privathaftpflicht (Familientarif) | Schützt vor existenziellen Forderungen, Beitrag meist sehr gering. |
| Rechtsstreitigkeiten privat/beruflich | Sollte | Rechtsschutzversicherung | Besonders für Arbeits-, Miet- und Privatrecht nützlich, auch wenn du Jurist bist. |
8. Reiseversicherungen für anwaltliche Familien
Wenn ihr als Familie zwei Urlaube pro Jahr plant, summieren sich die Reiseausgaben schnell. Gleichzeitig steigt mit kleinen Kindern die Wahrscheinlichkeit, dass kurzfristig eine Erkrankung oder ein anderer Zwischenfall eintritt. Deshalb lohnt sich ein Blick auf passende Reiseversicherungen.
8.1 Auslandsreisekrankenversicherung
Eine Auslandsreisekrankenversicherung schließt Lücken der GKV beziehungsweise PKV im Ausland und übernimmt neben der medizinischen Behandlung vor Ort insbesondere den medizinisch sinnvollen Rücktransport nach Deutschland. Gerade dieser Punkt ist in der gesetzlichen Krankenversicherung nur eingeschränkt abgesichert.
In vielen Fällen bietet ein Familienjahresvertrag einen breiten Schutz für alle Reisen des Jahres und ist gleichzeitig sehr kostengünstig.
8.2 Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung
Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherungen werden häufig in einem Paket angeboten und sind besonders sinnvoll, wenn ihr teurere Urlaube bucht. Sie schützen euch vor Stornokosten, wenn ihr vor Reisebeginn aus versicherten Gründen absagen müsst, und vor finanziellen Verlusten, wenn ihr den Urlaub vorzeitig abbrechen müsst.
- Reiserücktritt: Erstattung der Stornokosten, z. B. bei schwerer Erkrankung eines Kindes kurz vor Abreise.
- Reiseabbruch: Erstattung nicht genutzter Reiseleistungen und Übernahme der Mehrkosten für die vorzeitige Rückreise.
8.3 Gepäckversicherung
Eine Gepäckversicherung kann sinnvoll sein, wenn hochwertige Gepäckstücke, Kinderwagen oder Technik mitreisen. Dennoch bleibt sie im Vergleich zu Auslandsreisekranken- und Reiserücktritt-/Abbruchversicherung eher ein ergänzender Baustein und sollte nicht an erster Stelle stehen.
9. Altersvorsorge & Vermögensaufbau: mehrere Standbeine
9.1 Warum das Versorgungswerk allein nicht reicht
Das Versorgungswerk bildet zwar eine solide Basis, es ist jedoch selten ausreichend, um deinen kompletten Lebensstandard im Alter zu finanzieren. Außerdem ist die Gestaltung wenig flexibel, und bestimmte Gestaltungswünsche lassen sich nur begrenzt abbilden. Aus diesen Gründen solltest du weitere Vorsorgebausteine aufbauen.
9.2 Die drei Schichten der Altersvorsorge
- Schicht 1: Basisversorgung über das Versorgungswerk, ergänzt um eine Basisrente (Rürup), sofern steuerlich attraktiv.
- Schicht 2: Betriebliche Altersversorgung (bAV) über die Kanzlei.
- Schicht 3: Private Altersvorsorge, zum Beispiel fondsgebundene Privatrenten und weitere Kapitalanlagen.
9.3 Fondsgebundene Privatrenten mit ETF-Anlagemotor
In der dritten Schicht kannst du fondsgebundene Rentenversicherungen nutzen, bei denen ETFs als „Anlagemotor“ eingesetzt werden. Dadurch kombinierst du renditeorientierten Kapitalaufbau mit der Option auf eine lebenslange Rente.
Solche Verträge bieten zum einen eine strukturierte Ansparphase und zum anderen eine Verrentungsoption. Zudem ergeben sich in vielen Konstellationen steuerliche Vorteile gegenüber einer reinen Direktanlage.
9.4 ETF-Sparplan: Geldanlage vs. Altersvorsorge
Ein ETF-Sparplan ist in erster Linie eine Geldanlage. Er eignet sich hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau. Im Unterschied zu einer Rentenversicherung ist jedoch keine lebenslange Rentenzahlung eingebaut, sodass du das sogenannte Langlebigkeitsrisiko – also die Frage „Reicht mein Geld bis zum Lebensende?“ – selbst managen musst.
Sinnvoll ist daher, beides zu kombinieren: Einerseits einen flexiblen ETF-Sparplan als liquiden Vermögensbaustein, andererseits vorsorgeorientierte Lösungen mit Verrentungsoption, die planbare Einkünfte im Alter sichern.
10. Prioritäten & Roadmap für angestellte Anwälte
10.1 Schritt-für-Schritt-Vorgehen
- Schritt 1: Einkommen und Arbeitskraft absichern (Versorgungswerk verstehen, Zwei-Vertrags-BU, Krankentagegeld).
- Schritt 2: Familie und Haus schützen (Risiko-LV, Wohngebäude, Hausrat, Glas, Privathaftpflicht).
- Schritt 3: Kinderabsicherung aufbauen (Invalidität, Kinder-Unfall mit Unfallrente und speziellen Kinderklauseln).
- Schritt 4: Krankenversicherung strategisch planen (GKV mit Zusatztarifen, Optionstarif für späteren PKV-Wechsel).
- Schritt 5: Reiseabsicherung für wiederkehrende Familienurlaube einrichten.
- Schritt 6: Altersvorsorge breiter aufstellen (alle drei Schichten nutzen und mehrere Standbeine kombinieren).
11. FAQ – Häufige Fragen angestellter Anwälte
11.1 Reicht das Versorgungswerk nicht aus – warum noch eine private BU?
Das Versorgungswerk bietet eine wichtige Basisrente. Es ist jedoch nicht darauf ausgelegt, dein volles Einkommen oder deinen aktuellen Lebensstandard zu ersetzen. Mit Mitte 30 sind deine Anwartschaften noch relativ niedrig. Deshalb schließt eine private BU die Lücke zwischen der Versorgungswerksrente und deinem tatsächlichen finanziellen Bedarf.
11.2 Wie hoch sollte meine BU-Rente als angestellter Anwalt sein?
Ein sinnvoller Zielwert liegt bei etwa 70–80 % deines Nettoeinkommens, wobei Leistungen des Versorgungswerks berücksichtigt werden. Zusätzlich solltest du – insbesondere bei PKV-Planung – den späteren PKV-Beitrag mitdenken. Wichtig ist, dass du im BU-Fall Kredit, Lebenshaltung und eine grundlegende Altersvorsorge weiter bedienen kannst.
11.3 Warum braucht meine Ehefrau als Teilzeitkraft eine BU?
Das Teilzeit-Einkommen deiner Ehefrau trägt zum Gesamtbudget bei und ermöglicht eure aktuelle Lebensgestaltung. Fällt es weg, müsstet ihr entweder Betreuungsleistung zukaufen oder du müsstest beruflich zurücktreten. Beides ist teuer. Eine BU-Rente für deine Frau federt diesen Effekt ab und sorgt für Stabilität.
11.4 Brauchen Kinder wirklich eine eigene Unfall- oder Invaliditätsversicherung?
Kinder haben keine BU-Option. Das finanzielle Risiko liegt daher weniger in einem entgehenden Einkommen, sondern in erhöhten Ausgaben für Betreuung, Therapie und Anpassungen im Alltag. Eine gute Kinder-Invaliditäts- oder Kinder-Unfallversicherung mit sinnvollen Zusatzleistungen und ggf. Unfallrente kann diese Mehrbelastung erheblich abmildern.
11.5 Wie funktioniert die Zwei-Vertragslösung in der BU konkret?
Bei der Zwei-Vertragslösung verteilst du deine BU-Rente auf zwei verschiedene Versicherer. Dadurch kannst du Untersuchungs- grenzen geschickter umgehen, Nachversicherungsoptionen doppelt nutzen und das Risiko auf zwei Gesellschaften verteilen. Im Leistungsfall werden beide Verträge geprüft, was zwar mehr Aufwand bedeutet, aber eben auch mehr Sicherheit bringen kann.
11.6 Was passiert mit meinen Versicherungen, wenn ich später Partner werde?
Idealerweise ist deine BU von Anfang an auf das Berufsbild „Rechtsanwalt“ ausgerichtet, nicht nur auf deine aktuelle Position als Associate. Wenn du Partner wirst, steigen Einkommen und Verantwortung deutlich. Deine BU, deine Risiko-LV und deine Altersvorsorge sollten dann überprüft und – über Nachversicherungsoptionen oder neue Bausteine – angepasst werden.
11.7 Wie viel Versicherung ist sinnvoll – und ab wann bin ich überversichert?
Eine sinnvolle Absicherung ist erreicht, wenn die existenziellen Risiken abgedeckt sind und die Prämien im Verhältnis zu deinem Budget stehen. Überversichert bist du, wenn teure Komfortpolicen oder Kleinstversicherungen mehr Raum einnehmen als die wirklich wichtigen Bausteine wie BU, Todesfall, Haftpflicht, Haus und Krankenversicherung.
12. Glossar – wichtige Begriffe
BU Berufsunfähigkeit
Versorgungswerk Berufsständische Versorgung
Krankentagegeld Lohnersatz bei längerer Krankheit
Optionstarif Zukunftsrecht in der PKV
Invalidität Dauerhafte Beeinträchtigung
Progression Leistungssteigerung bei schweren Unfällen
Elementarschäden Naturgefahren am Gebäude oder Hausrat
bAV Betriebliche Altersversorgung
Basisrente Rürup-Rente
Privatrente Lebenslange Rente aus Schicht 3
Risiko-LV Reine Todesfallabsicherung
13. Fazit & nächste Schritte
Als angestellter Anwalt bist du weder „normaler Angestellter“ noch klassischer Selbstständiger. Dein Versorgungswerk, deine Einkommensperspektive und deine familiäre Situation erfordern ein eigenes, durchdachtes Konzept: eine starke BU mit Zwei-Vertragslösung, eine klare Familien- und Hausabsicherung, eine kluge Krankenversicherungsstrategie sowie mehrere Standbeine in der Altersvorsorge.
Entscheidend ist, strukturiert vorzugehen: Zuerst sicherst du die existenziellen Risiken ab. Anschließend ergänzt du sinnvolle Komfortbausteine und baust parallel systematisch Vermögen für später auf.
Eine unabhängige, auf Kammerberufe spezialisierte Beratung kann dabei helfen, deinen individuellen Mix aus Versorgungswerk, privaten Versicherungen und Kapitalanlagen aufeinander abzustimmen – ohne unnötige Lücken oder teure Doppelstrukturen.

